Projektmanagement bei der Bahn
- Stephan Bellmann
- 21. Apr. 2025
- 25 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 14. Nov. 2025
Dorothee und Christian über die Leitung, das Projektmanagement und die richtige Kommunikation in einem Großprojekt bei der Bahn.
Inhalt
Kernaussagen des Interviews
Metadaten
Über Dorothee und Christian
Doro ist erfahren im Projekt- und Programmmanagement sowie im Marketing. Aktuell leitet sie bei der DB InfraGO AG technische Produktionsprogramme und ein eigenes Team. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bahn tätig.
Ihre vorherigen Stationen umfassen leitende Rollen bei Agenturen wie antoni Berlin (Mercedes-Benz) und Fischer and Friends. Dort verantwortete sie Kampagnen für namhafte Kunden. Ergänzt wird ihre Erfahrung durch internationale Erfahrungen im Sport- und Eventmarketing.
Christian verfügt über langjährige Erfahrung im technischen Projektmanagement. Seit Juli 2024 ist er als Referent für den Programmrollout bei der DB InfraGO tätig, nachdem er zuvor bereits als technischer Projektleiter bei der Deutschen Bahn und DB InfraGO AG Verantwortung übernommen hatte. Davor arbeitete er über sieben Jahre als Projektmanager bei der tp management GmbH in Dresden. Sein Schwerpunkt liegt auf der Steuerung komplexer Infrastrukturprojekte.

Zusammenfassung des Interviews
Doro und Christian berichten in ihrem Gespräch über ihre persönlichen Werdegänge und ihre Erfahrungen im Projektmanagement – insbesondere in einem Großkonzern wie der Deutschen Bahn, wo sie derzeit gemeinsam an einem umfangreichen Digitalfunkprojekt arbeiten.
Doro absolvierte ihren Bachelor in Business Administration in Florida, finanziert durch ein Golfstipendium. Nach dem Studium sammelte sie erste Berufserfahrung durch Praktika in den USA und anschließend in der Schweiz, bevor sie in ihre Heimat zurückkehrte und bei einer Agentur ihre Leidenschaft für Projektmanagement entdeckte. Christian hingegen hat Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen in Leipzig studiert, zunächst im Diplomstudiengang, dann im Master. Während des Studiums arbeitete er als Werkstudent, um praktische Erfahrung zu sammeln. Nach seinem Abschluss 2012 startete er in einem Projektsteuerungsbüro im Bereich Digitalfunk, obwohl ihn das Thema Projektmanagement anfangs wenig reizte. Mit der Zeit erkannte er jedoch die Vielseitigkeit und Relevanz dieser Arbeit. Später wechselte er zur Deutschen Bahn, wo er erneut mit Funkprojekten betraut wurde.
Obwohl Doro in Berlin und Christian in Leipzig arbeiten, funktioniert die Zusammenarbeit dank digitaler Tools und durch Corona etablierter Remote-Strukturen reibungslos. Beide betonen die Herausforderungen und Besonderheiten des Projektmanagements in einem Großkonzern. Doro bringt ihre Erfahrungen aus kleineren Agenturen ein und stellt fest, dass in Großprojekten strukturierte Methoden wie Stakeholderanalysen deutlich wichtiger sind. Zwar werden diese selten lehrbuchartig durchgeführt, doch helfen sie, Beteiligte zu identifizieren und ihre Rollen zu klären – besonders für neue Teammitglieder ein großer Vorteil.
Christian hebt hervor, dass in großen Unternehmen Erfahrung oft mehr zählt als formale Vorgaben. Der Satz „Das haben wir schon immer so gemacht“ könne zwar problematisch sein, sei aber häufig Ausdruck von bewährtem Wissen. Er plädiert dafür, Regularien als Orientierung zu nutzen, sie jedoch nicht zu starr auszulegen, um Flexibilität zu wahren. Beide sind sich einig, dass eine gute Balance zwischen Regeln, Pragmatismus, Erfahrung und Innovationsbereitschaft entscheidend für den Projekterfolg ist.
Ein zentrales Thema ist der Umgang mit Veränderungen im Projektverlauf. Doro betont die Notwendigkeit von Flexibilität, während Christian verschiedene Planungsansätze beschreibt – entweder eine möglichst detaillierte Anfangsplanung oder eine rollierende Anpassung. Wichtig sei, dass alle Beteiligten verstehen, dass Änderungen zum Projektalltag gehören, auch wenn es irgendwann einen „Cut“ geben muss, um das Projekt zu finalisieren.
Die beiden sprechen auch über die besondere Herausforderung der Kommunikation in großen Programmen mit vielen Akteuren. Unterschiedliche Perspektiven und Verantwortlichkeiten führen schnell zu Missverständnissen. Die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und verständlich zu vermitteln, sei daher essenziell. Führung bedeutet in diesem Kontext vor allem Moderation und der sensible Umgang mit Diversität. Doro betont die Bedeutung klarer Verantwortlichkeiten, während Christian das „Lesen“ von Menschen als wichtige Fähigkeit nennt – zu erkennen, wer Verantwortung übernimmt und wer nicht. Empathie, ergänzt Doro, sei dabei zentral, um Situationen und Personen richtig einordnen zu können.
Emotionen sehen die beiden nicht als Störfaktor, sondern als produktives Element, das kreative Impulse liefern kann. Harte, aber respektvolle Diskussionen und die Vielfalt an Sichtweisen bereichern die Projektarbeit.
Methodisch greifen beide auf klassische Werkzeuge wie Projektstrukturpläne, Terminpläne und Stakeholderanalysen zurück. Ergänzend nutzen sie bei Bedarf auch agile Methoden wie Kanban, obwohl im baunahen Umfeld meist klassisch gearbeitet wird.
Auch das Thema Führung wird intensiv beleuchtet: Doro betont die Bedeutung von Vorbildfunktion und Vertrauen, während Christian eine sichtbare, strategisch denkende Führungspersönlichkeit fordert – vergleichbar mit einem Spielführer im Sport. Diese Klarheit sei zentral für Motivation und Teamzusammenhalt.
In der zentralen Projektkoordination sieht Christian vor allem das strukturierte Berichtswesen als entscheidend, um Entscheidungsprozesse auf höherer Ebene zu unterstützen. Doro ergänzt die Bedeutung des bereichsübergreifenden Wissensaustauschs, um Silodenken zu vermeiden und das große Ganze im Blick zu behalten.
Abschließend äußern sich beide zum Umgang mit externen Mitarbeitenden. Sie sehen in ihnen eine wertvolle Ressource, die durch neue Perspektiven und kritisches Hinterfragen frischen Wind ins Projekt bringt. Wichtig sei, alle Beteiligten – unabhängig vom Vertragsverhältnis – gleichwertig zu behandeln, denn entscheidend sei das gemeinsame Ziel.
Insgesamt zeigt das Gespräch, dass Projektmanagement weit über methodische Prozesse hinausgeht. Es erfordert Kommunikationsstärke, Verantwortungsbewusstsein, Führungsfähigkeit, Empathie und den produktiven Umgang mit Vielfalt. Die zentrale Koordination spielt dabei eine Schlüsselrolle, indem sie Informationen bündelt, den Überblick wahrt und Impulse für eine erfolgreiche Umsetzung liefert.
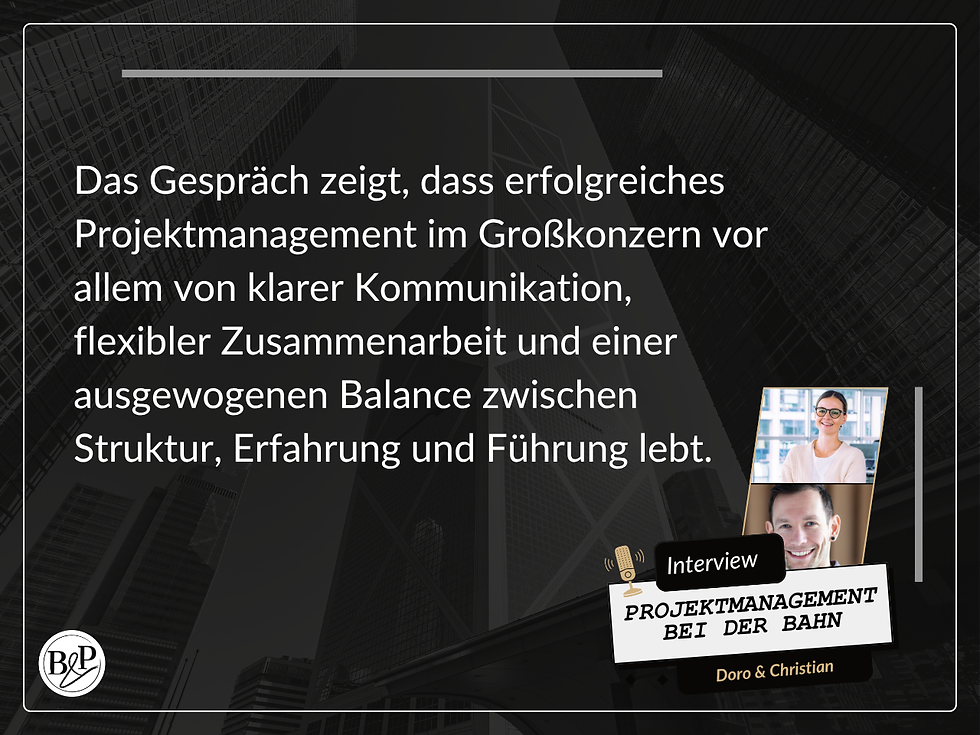
Kernaussagen des Interviews
1. Projektmanagement im Großkonzern
In großen Organisationen wie der Deutschen Bahn ist ein strukturierteres Projektmanagement von zentraler Bedeutung, da die Komplexität und Anzahl der Beteiligten deutlich höher ist als in kleineren Firmen. Methoden wie die Stakeholderanalyse spielen dabei eine essenzielle Rolle, auch wenn sie in der Praxis selten in ihrer Lehrbuchform umgesetzt werden. Gleichzeitig zeigt sich, dass durch Digitalisierung und die etablierten Möglichkeiten der Remote-Arbeit eine reibungslose Zusammenarbeit auch über räumliche Distanz hinweg gut funktionieren kann.
2. Regularien vs. Erfahrung
Im Spannungsfeld zwischen Regularien und Erfahrung zeigt sich, dass Regelwerke zwar notwendig sind, um Struktur und Orientierung im Projekt zu gewährleisten, sie jedoch nicht so starr sein dürfen, dass sie die notwendige Flexibilität einschränken. Erfahrungswissen erweist sich in der Praxis oft als hilfreicher als theoretische Ansätze – besonders in der internen Kommunikation und bei der Priorisierung von Aufgaben. Der häufig kritisierte Satz „So haben wir das schon immer gemacht“ kann durchaus von Nutzen sein, wenn er auf bewährten und funktionierenden Vorgehensweisen basiert.
3. Umgang mit Veränderungen
Veränderungen sind im Projektalltag unvermeidlich, da stabile Verläufe die Ausnahme darstellen. Grundsätzlich gibt es zwei Herangehensweisen im Umgang mit Veränderungen: eine möglichst detaillierte Planung zu Beginn oder eine rollierende, also fortlaufend angepasste Planung. Unabhängig vom gewählten Ansatz ist es entscheidend, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, an dem die Planung „eingefroren“ werden muss, um das Projekt konkret umzusetzen und erfolgreich abzuschließen.
4. Kommunikation als Schlüsselfaktor
Kommunikation ist ein zentraler Erfolgsfaktor in großen Projekten, da gezielte Wissensverteilung entscheidend für das Verständnis aller Beteiligten ist. Unterschiedliche Perspektiven und Verantwortlichkeiten bergen das Potenzial für Missverständnisse, weshalb gegenseitiges Verständnis eine wichtige Grundlage bildet. Eine klare und kontinuierliche Kommunikation hilft dabei, Zusammenhänge transparent zu machen und Akzeptanz für Entscheidungen und Prozesse zu schaffen.
5. Mensch im Mittelpunkt
Im Mittelpunkt eines Projekts stehen die Menschen mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten, Erfahrungen und Erwartungen. Eine gute Projektleitung zeichnet sich durch Moderation, Empathie und klare Führung aus. Dabei sind emotionale Debatten keineswegs negativ, denn Reibungen können wertvolle Impulse geben und Innovationen fördern.
6. Führung
Führungskräfte sollten als Vorbilder agieren, Vertrauen schaffen und klare Entscheidungen treffen. Gute Führung zeigt sich dabei sowohl in einer sichtbaren, strategisch leitenden Rolle als auch in einer nahbaren, empathischen und moderierenden Haltung.
7. Methoden im Projektmanagement
Klassische Werkzeuge im Projektmanagement wie Projektstrukturpläne, Terminpläne und Stakeholderanalysen behalten ihre Bedeutung. Agile Methoden, etwa Kanban, können vor allem bei kleineren Teilprojekten eine sinnvolle Ergänzung darstellen.
8. Rolle der zentralen Koordination
Die zentrale Koordination spielt eine wichtige Rolle, indem sie das Berichtswesen und die Aufbereitung von Informationen übernimmt, was für eine effektive Steuerung und Priorisierung unerlässlich ist. Durch den Wissensaustausch über Projektgrenzen hinweg wird ineffizientes „Silo-Denken“ vermieden. Insgesamt sorgt die zentrale Sichtweise dafür, den Überblick zu behalten und handlungsfähig zu bleiben.
9. Externe Mitarbeitende als Mehrwert
Externe Mitarbeitende bieten einen großen Mehrwert, indem sie neue Perspektiven und Innovationsimpulse ins Projekt bringen. Dabei ist es wichtig, alle Beteiligten gleichwertig zu behandeln, unabhängig von ihrem Vertragsstatus. Im Vordergrund stehen das gemeinsame Ziel und das Engagement aller Beteiligten.
Interview
Doro, ich glaube, du stellst uns beide komplett in den Schatten. Dein Werdegang ist schon wirklich beeindruckend. Fangen wir mal so an: wo und was hast du studiert?
Doro
Das war in Florida und da habe ich Business Administration studiert.
Bachelor oder Master?
Doro
Das war im Bachelor.
Und danach bist du in den USA geblieben. Oder bist du direkt wieder zurück?
Doro
Genau, du bekommst in den USA nach dem Studium immer noch ein Visum für ein Jahr, für ein praktisches Training. Das habe ich genutzt und zwei Praktika dran gehängt, um das Gelernte aus dem Studium anzuwenden.
Stark! Und dann hast du dort Golf gespielt, habe ich das richtig gesehen?
Doro
Ich habe mir das Studium mit dem Golfstipendium finanziert.
Hast du das professionell gemacht?
Doro
Also nicht professionell, lediglich in der Uni-Mannschaft, um damit mein Studium zu finanzieren. Aber nicht profimäßig, davon war ich weit entfernt.
Aber du bist in jedem Fall besser als Christian und ich.
Christian
Ich habe in meinem Leben noch keinen Golfschläger in der Hand gehabt, der über Minigolf hinausgeht. Der Vergleich lässt sich gar nicht aufstellen.
Doro
Ihr habt aber meistens mehr Glück als jeder andere.
Und dann bist du zurückgekommen und hast deine Erfahrungen gemacht. Was hast du da gemacht an vielen Stationen? Erzähl doch mal ein bisschen.
Doro
Ich habe nach dem Studium, als ich wieder in Europa angekommen bin, in der Schweiz ein halbes Jahr gearbeitet. Bin dann zurück in die alte Heimat gegangen und habe in einer Agentur angefangen. Dort habe ich die Liebe fürs Projektmanagement entwickelt.
Und Christian, du hast in Leipzig studiert, richtig?
Christian
Genau, bei mir ist es sehr viel weniger spektakulär. Ich habe sechs Jahre in Leipzig studiert, habe dann hier einen Job-Einstieg gefunden und bin immer noch hier.
Hast du den Diplom oder den Master?
Christian
Beides. Ich bin Diplom-Wirtschaftsingenieur für Bauwesen. Nicht Uni, sondern Fachhochschule. Und wir hatten die Option dann gleich noch für zwei Jahre den Master of Science hinten dran zu hängen. Und da habe ich gesagt, ich würde mich immer ärgern, wenn ich die Chance nicht ergreife. Das Diplomstudium war übrigens am Anfang sehr schulisch, was ich gut fand, weil ich mir gesagt habe, wenn ich mir an der Uni aussuchen kann, ob ich hingehe oder nicht, weiß ich, dass ich nicht hingehen werde. Deswegen fand ich das gut, dass es so strukturiert war. Dort hat es aber keine Möglichkeit gegeben, mal nach rechts oder links zu gucken. Während des Masters konnte man sich dann die Sachen raussuchen, die einem Spaß gemacht haben. Da habe ich dann tatsächlich Brandschutz, Kunststoff und Glasbau und solche Sachen belegt, die wirklich viel mit Bau zu tun hatten.
Wenn ich das richtig raus höre, fandest du den Master besser als das Diplom?
Christian
Es war eine gute Ergänzung. Es war super, dass ich das Diplom gemacht habe. Das war genau in der Form, wie ich mir das vorgestellt habe, weil da war vorgegeben, was man machen muss, um den Abschluss zu bekommen. Und der Master hat aber viel mehr Optionen gegeben. In der Hochschule kannte man die Kurse, man kannte die Inhalte und konnte sich dann Dinge aus einem gewissen Portfolio aussuchen, wofür man Interesse hatte und was einem die letzten vier Jahre während des Diplomstudiengangs gefehlt hat.
Ein Privileg würde ich sagen.
Christian
Absolut. Das haben meine Eltern zum Glück mitgemacht. Ich war nebenher noch Werkstudent in einem Ingenieurbüro, wo ich noch gearbeitet habe, um so das Studium ein bisschen mitfinanziert zu bekommen.
Das Studium hast du 2012 abgeschlossen, richtig?
Christian
Richtig, seitdem bin ich Arbeitnehmer und zahle in die Rentenkasse ein. Ich habe dann nach meinem Studium hier in Leipzig bei einem Projektsteuerungsbüro angefangen. Die haben mich gleich ein bisschen überfahren mit Projektsteuerung im Rollout von Digitalfunk.
Das war bei TP-Management GmbH?
Christian
Ja. Genau, da habe ich noch gedacht, das liegt mir ja gar nicht mit dem Projektmanagement. Ich wollte irgendwie Sachen bauen. Als Werkstudenten waren wir auf Baustellen, wir haben Beton gerochen, den Bauüberwacher an die Hand genommen, hast eine Menge Kontrollen gemacht und jetzt war es so wahnsinnig theoretisch und dazu noch mit einer Technik, die ich überhaupt gar nicht kannte. Und letztendlich habe ich gemerkt, dass es egal ist, ob ich einen Rohbauer, einen Estrichleger, einen Fliesenleger koordiniere oder ob ich sag, da muss etwas technisch gebaut werden, damit ein Mast draus wird. Das ist einfach nur ein anderes Gewerk und da bin ich dann sieben Jahre dabei geblieben.
Und dann bist du auch direkt danach bei der Bahn gelandet.
Christian
Genau, das ist tatsächlich die zweite feste Arbeitsstation, wenn ich das Werkstudententum vorher rausnehme. Ich wollte mal was anderes machen als Funk. Das hat ja dann super geklappt. Ich war keine drei Monate da, als mir angeboten wurde, Mensch Christian, wir haben gehört, du hast Erfahrung im Funk. Es käme ein neues Programm auf uns zu, hättest du Lust uns dabei zu unterstützen? Und ich sagte dann ja.
Ich habe anfänglich dann noch parallel an Bahnsteig-Projekten gearbeitet, habe dann aber schnell gemerkt, dass das nicht gleichzeitig geht und habe mich dann wieder voll dem Funk gewidmet.
Ja, das nutze ich mal als perfekten Übergang, weil man muss fairerweise dazu sagen, dass wir alle drei im gleichen Projekt tätig sind. Ihr seid zentralseitig unterwegs, ich bin im Regionalbereich und es geht dabei um BOS-Digitalfunk. Das heißt, wir kennen das Thema, worüber wir gleich sprechen, und das Projektmanagement, das uns dabei begleitet. Und genau da können wir direkt mal reingehen. Ihr beide seid in der Zentrale, das heißt, ihr beide arbeitet auch tagtäglich miteinander!?
Christian
Ich wohne in Leipzig, dort befinde ich mich aktuell auch und ich war vorher technischer Projektleiter im Regionalbereich Südost. Ich bin jetzt seit Juli erst zentralseitig angeordnet, aber trotzdem arbeiten wir jeden Tag zusammen. Die Digitalisierung hat bei der Bahn so wahnsinnig gut funktioniert, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Corona hat gezeigt, dass es wirklich von heute auf morgen zu 100 Prozent funktioniert hat.
Und so funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Leipzig und Berlin aus meiner Sicht sehr gut.
Jetzt ist es so, dass die Bahn ein Riesenunternehmen ist. Projektmanagement in einem mittelständischen Unternehmen oder in einem kleinen Unternehmen ist anders.
Und da gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen. In einem kleinen Unternehmen hat man wahrscheinlich viel mehr Freiheiten, man hat viel mehr Verantwortung, man kann viel mehr bewegen. In einem großen Unternehmen ist man da schon eher den Regularien unterlegen. Ist das für euch eine Herausforderung, mit den vielen Regularien und der Bürokratie umgehen zu müssen bei der Bahn?
Doro
Ja, ich habe davor in zwei kleineren Unternehmen / Agenturen gearbeitet - mit dem Fokus auf Kommunikation und in der Betreuung mittelständischer Unternehmen. Beispielsweise eine Stakeholderanalyse braucht man in einem Unternehmen mit 15, 30 oder 40 Mitarbeiter nicht.
Aber für ein Projekt, das du betreust in einem größeren Unternehmensumfeld wie der Deutschen Bahn, ist das eigentlich eine Grundlage, weil du ohne Stakeholdermanagement überhaupt nicht zurecht kommst.
Das ist ein gutes Stichwort, weil das wirklich sehr interessant ist. Stakeholdermanagement ist ja in der Theorie ziemlich klar definiert, beispielsweise im Rahmen einer PM-Zertifizierung. Aber in der Praxis ist es ja dann doch immer ganz anders. Also es macht ja in der Praxis niemand eine Stakeholderanalyse nach Lehrbuch. Oder wie macht ihr das, Doro?
Doro
Genau, eigentlich zu Beginn eines Projektes sollte man damit loslegen und es ist wirklich eine wichtige Methode, sich Gedanken zu machen, wer ist alles beteiligt und welchen Einfluss haben sie aufs Projekt und wie wollen wir mit den Stakeholdern zusammenarbeiten und kommunizieren. Für so einen großen Umfang eines Projekts, wie wir es bei der DB betreuen, finde ich schon, dass es wahnsinnig relevant ist.
Und wie geht ihr damit im praktischen Alltag um? Habt ihr dazu eine Tabelle oder ein Diagramm?
Doro
Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema Deutsche Bahn. Es gibt einfach sehr viele Prozesse, sehr viele Vorgaben. Bei uns sind es eher einzelne Tabellen und auch Powerpoint-Präsentationen, in denen verschiedene Teilnehmerkreise und Stakeholder aufgeführt sind.
Also ich weiß, dass es bei vielen sehr pragmatisch läuft. Viele sagen sich: Stakeholder-Analyse schön und gut. Aber ich weiß ja, mit wem ich gerade Projektmanagement mache und ich weiß ja auch, wie ich mit meinen Stakeholdern umgehe. Ich durfte letztens noch ein sehr gutes Interview mit Jan Köster durchführen, der auch Kurse zu den entsprechenden Zertifizierungen gibt. Und der hält die Stakeholder-Analyse tatsächlich für sehr wichtig, um beispielsweise neue Projektbeteiligte schnell und richtig einordnen zu können. Oder auch wenn intern neue Mitarbeiter dazukommen, dass diese eine schnelle Übersicht darüber bekommen, wer eigentlich alles zum Projekt dazugehört, weil der neue Mitarbeiter ja noch nicht alle Projektbeteiligte kennt.
Was ich auch feststelle ist, dass es gerade in großen Unternehmen viele Regularien gibt, aber trotzdem im Endeffekt oft die Subjektivierung gewinnt. Also sehr viele Regularien treffen auf subjektive Mitarbeitererfahrung und am Ende weiß es ein sehr erfahrener Mitarbeiter im Zweifel besser, weil es sowieso viel zu viele Regularien gibt, wo keiner mehr durchblickt. Dann vertrauen wir eben doch auf den erfahrenen Mitarbeiter. Wie ist das bei euch Christian?
Christian
Das ist absolut so. “Das haben wir schon immer so gemacht.” Das ist zwar ein blöder Satz, aber es hat sich trotzdem etabliert, sich auf Erfahrung zu verlassen. Von der Bauumsetzung bis hin zur Kommunikation im strategischen Bereich. Da gibt es Beteiligte, die einfach wissen, wie jemand zu händeln ist, wie Fach- und Sachthemen zu beantworten sind und wie diese bearbeitet werden. Wenn ich beispielsweise etwas mit einem Mitarbeiter klären will, dann passe ich den lieber am Kaffeeautomat ab, statt das Thema in einem offiziellen Termin zu besprechen. Sowas kannst du nur mit Erfahrung effektiv umsetzen. Da hilft dir keine Richtlinie, da hilft dir kein aufgeschriebener Prozess, an den sich alle halten.
Es gibt halt diejenigen, die sich eher an den Regularien orientieren und die anderen, die vielleicht ein bisschen mehr out of the box denken und da treffen schon mal Welten aufeinander.
Doro
Ich glaube, Vorgaben sind ab einem gewissen Organisationsumfang wichtig, weil sonst jeder macht, was er will. Aber andererseits dürfen sie nicht so einschränkend sein, dass es den Freiraum nimmt zu entscheiden oder Verantwortung zu übernehmen.
Das ist aus meiner Sicht die Herausforderung. Wo fangen Vorgaben und Prozesse an und wo hören sie auf, um noch den Gestaltungsspielraum für Projektteams zu belassen.
Das ist ein Problem, wenn ich das richtig raushöre. Also zu viele Regularien, worin man sich versumpft, um es bildlich auszudrücken.
Christian
Genau, alles in eine Schablone zu pressen, jede Konstellation, jede Frage, jede Antwort schon mal vorgedacht zu haben, das funktioniert nicht in allen Details. Und wenn die Einhaltung eines konkreten Rahmens eingefordert wird, dann hindert es, dann ist es ein Problem, genau.
Doro
Und oft sind es auch Prozesse, die denkst du dir anhand von ein oder zwei Beispielen aus, und am Schluss sollen sie aber für fünf andere Sachen anwendbar sein. Und meistens kommt das Problem zustande, wie wir es ja auch in unserem Projektumfeld sehen. Beispiel: Du hast eine Vorgabe für so eine Standardanlage. Wie soll die funktionieren? Was soll die können? Wie soll der Projektablauf sein? Wie soll die Timeline dafür sein? Welche Termine, welche Abstimmungsschritte soll ich einplanen? Und dann gibt es aber auch noch aufgrund von unterschiedlichen beteiligten Stakeholdern unterschiedliche Anforderungen, die aber in keinem Prozess drin stehen.
Das ist auch so ein guter Punkt. Ich war jetzt in Thailand unterwegs und da wird natürlich alles sehr viel pragmatischer umgesetzt. Die Thailänder würden wahrscheinlich sagen, wir klatschen einfach einen Router im Bahnhof an die Wand und dann habt ihr eure Anlage versus da ist keine Anlage verbaut. Das funktioniert doch wunderbar. Also, was wollt ihr mit den vielen Regularien? Wir hingegen müssen darauf achten, dass wenn beispielsweise Auflagen von Fachspezialisten aufgestellt werden, dass die zu erstellenden Stellungnahmen in einem richtigen Format ankommen. Denn sonst werden diese nicht anerkannt und die Anlage kann somit nicht abgenommen werden.
Wahrscheinlich ist mal wieder die Mitte die Lösung. Also, zu viele Regularien verstopfen den Projektfortschritt und zu viel Freiraum bzw. Pragmatismus geht vielleicht auf Kosten der Sicherheit, denn das mit der Sicherheit haben wir in Deutschland ja schon sehr gut im Griff.
Christian
Es hindert halt auch mal Übung darin zu bekommen, eigene Ideen einzubringen. Da braucht man nicht drüber nachdenken, kein Gehirnschmalz reinstecken, das läuft genau in diesem einen Rahmen und in einem anderen Rahmen kann das Problem nicht beantworten werden. So komme ich da gar nicht raus, weil ich überhaupt gar keine Idee habe, wie ich das mache, das Problem mal von hinten anzuschauen, mal zu sagen, wie könnte ich denn eine Lösung entwickeln, wie könnte ich denn mit anderen Beteiligten einfach mal ins Gespräch gehen. Und ich glaube, das muss man auch manchmal üben.
Aber sind wir hier nicht an einem Punkt, wo wir den Kreis zum vorangegangenen Thema schließen können? Wo man sagt, okay, der erfahrene Mitarbeiter kann ja genau das auch nicht. Der ist zwar sehr erfahren in seinem Umfeld und kennt zum Beispiel die Bahn auch sehr gut und die ganzen Prozesse. Aber dadurch denkt er ja nicht out of the box, weil er beispielsweise schon seit 20 Jahren bei der Bahn arbeitet und somit nur diesen einen Weg sehr gut kann. Da gucken vielleicht neue Mitarbeiter in dem Projekt aus einem ganz anderen Blickwinkel auf die Probleme. Und die könnten ja genau diesen Ansatz, den du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich viel besser thematisieren als der langjährige Mitarbeiter.
Christian
Genau, du hast ja aber gefragt, ob die Regularien oder die Erfahrung das regeln. Das ist, glaube ich, immer noch was anderes, wenn du sagst, das hat sich in meinem täglichen Doing etabliert, oder ich darf nicht anders, weil es niedergeschrieben steht. Aber ich bin absolut bei dir. Beides führt dann dazu, dass man seinen Horizont sehr verringert. Und da muss man mit neuen Impulsen, Personen oder Ideen oder anderen Maßnahmen versuchen, rauszukommen.
Also die Kombination aus Erfahrung, Regularien, neuen Mitarbeitern und out of the box ist wahrscheinlich sehr wichtig.
Doro
Genau, weil da schließt sich ja eigentlich der Kreis mit dem du angefangen hast. Also man sagt, der eine hat mehr Erfahrung, der andere hat weniger Erfahrung. Dazwischen stehen die Regularien. Aber genau so wie Christian gesagt hat. Der erfahrene Mitarbeiter, der es vielleicht schon immer so macht, macht es jetzt deswegen auch nicht falsch. Aber der, der neu dazukommt, der muss auch den Freiraum haben, Dinge anders zu machen. Und zwischen den zwei Perspektiven stehen ja eigentlich die Regularien, die eine Richtung vorgeben und sagen, daran müsst ihr euch halten, aber der Rest, da seid ihr frei.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Wie ist das mit Änderungen? Ein Projekt ist ja ein Projekt, weil man gerade keine Routinen abarbeitet und nicht genau vorhersehen kann, wie man die definierten Ziele genau erreicht. Dass es Änderungen geben wird, ist ja so gut wie sicher. Wie geht ihr mit Änderungen um bzw. welchen Impact haben gewisse Änderungen?
Doro
Das ist tatsächlich schwer zu sagen, denn in dem Umfang oder in der Größe bräuchtest du eigentlich eine Art Change-Prozess. Also wie gehe ich damit um, wenn was Neues reinfliegt oder eine neue Vorgabe dazukommt. Und natürlich möchte man sich am liebsten davor versperren und sagen, mein Programm/Projekt geht drei Jahre und ich arbeite das jetzt so ab, wie es definiert wurde. Aber um den Blick in die Realität zu wagen und ich glaube die Erfahrung hat jeder gemacht, der bereits ein Projekt, ein Event oder etwas ähnliches organisiert hat: es wird nie komplett danach laufen, was ich mal am ersten Tag auf den Zettel geschrieben habe, weil sich alles weiterentwickelt. Das Umfeld unterliegt immer irgendwelchen Schwankungen.
Wir müssen uns in den Projekten daran anpassen und somit ist so ein Projekt doch in irgendeiner Form ein sehr agiles Umfeld, in dem man ein bisschen flexibel sein muss und auch diese Dinge berücksichtigen muss.
Christian
Man kann natürlich am Anfang versuchen, das möglichst genau zu definieren, oder man läuft eben erstmal los und sagt, wir definieren es dann in rollender Planungen. Aber dann muss eben allen Beteiligten auch klar sein, dass wir ein Programm haben, was der rollenden Planung unterliegt. Wenn man aber sagt, das ist mir ein bisschen zu wenig Zielstellung und zu wenig Definition der Parameter und trotzdem 100 % Ergebnis erwartet, dann passt das nicht ganz zusammen. Also muss auch allen Beteiligten klar sein, dass wir Änderungen haben werden, Anpassungen haben werden, Konkretisierungen haben werden, die wir aber irgendwann im Laufe des Projektes auch mal einfrieren müssen.
Doro
Ich finde an der Stelle merkt man auch ganz gut, je größer das Unternehmen ist, desto schwerer ist es natürlich auch, solche Änderungen einzubringen.
Ja, völlig richtig. Das Projektmanagement in dem einen Projekt ist nicht gleich das Projektmanagement in dem anderen Projekt. Aber wie ist das bei euch im Projekt? Was würdet ihr sagen, ist da die größte Herausforderung im Projektmanagement.
Doro
Bei uns, aber auch generell würde ich behaupten, eines der wichtigsten Themen im Projekt ist die Kommunikation, weil du so viele Teilnehmer/verschiedene Stakeholder und so viele Informationen hast, dass sich jeder an jeder Stelle abgeholt fühlen muss. Das finde ich gerade aus dem zentralen Blick bei uns im Programm eine wahnsinnig große Herausforderung. Denn das Wissen ist an vielen Stellen da, aber du musst das Wissen erstmal an die richtigen Stellen transportieren.
Christian
Ich glaube, in der Vielzahl der Beteiligten ist Kommunikation das Wichtigste. Von denjenigen, die die Schraube in die Wand drehen, bis zu denjenigen, die gegenüber dem Vorstand vertreten müssen, warum die Kurven flacher sind, als sie hätten sein müssen. Da ist eine wahnsinnige Bandbreite an Herausforderungen, die abgestimmt werden müssen. Und für die man aber gegenseitig kein Verständnis hat, weil da sozusagen die Kenntnisse der Abläufe fehlen. Auf der einen Seite Diejenigen, die unten mit der Schraube nicht wissen, warum man das jetzt nicht so abrechnen kann, weil das irgendwie gar nicht in der Vorgabe steht und gleichzeitig Diejenigen, die sich die Kurven nur angucken und gar nicht verstehen, warum hinten der eine Stempel fehlt und der dafür sorgt, dass wir den ganzen Bahnhof nicht bauen können. Und dafür das Verständnis zu entwickeln ist eine große Herausforderung.
Der eine meint, dass es doch jetzt nicht an diesem Stempel scheitern kann und der andere sagt natürlich, mit diesem Stempel habe ich mich eine ganze Woche rumgeschlagen. Und dafür so ein stückweit die Sensibilisierung offen zu halten, dass die Entscheidungen, die getroffen werden oder die Entscheidungen, die nicht getroffen werden, einen wahnsinnigen Einfluss darauf haben können, was zum Schluss zu einem Projekterfolg führt und was nicht.
Der Einflussfaktor Mensch ist ja ein großes Thema im Projektmanagement. Alle Individuen, die mit verschiedenen Sichtweisen das Projekt versuchen zu steuern und umzusetzen, das ist eine enorme Herausforderung. Seht ihr das in eurem Umfeld auch so?
Christian
Natürlich würde es ohne die Menschen nicht funktionieren, das würde auch wahnsinnig langweilig sein. Ich glaube, das wollten wir alle nicht. Und gleichzeitig gilt es, unterschiedliche Erwartungshaltungen zu verheiraten. Genau das ist die Herausforderung und da stehen sich Menschen gegenüber, die alle moderiert werden wollen.
Das ist doch ein Pain, wenn sich eine Gruppe auf etwas einigt und es dann einen gibt, der das ganz anders sieht und das Vorhaben und die Entscheidung der Gruppe dann verhindert? Wie geht ihr damit um Doro?
Doro
Ich finde, da ist das Thema Verantwortung ein total wichtiges Thema, was eine große Herausforderung werden kann. Wenn allen klar ist, welche Verantwortung an welcher Stelle in diesem Projekt wichtig ist und für was ich zuständig bin und welche Entscheidungen ich treffen muss und welche Auswirkungen diese Entscheidungen hervorbringen.
Je mehr an einem Projekt beteiligt sind, desto mehr verschwimmen diese Verantwortungsbereiche.
Ja, sehr gut beschrieben mit der Aufteilung des Verantwortungsbereiches.
Bei vielen Projektbeteiligten überschneiden sich natürlich auch Verantwortungsbereiche. Ein gutes Beispiel haben wir die Tage noch diskutiert: Warum planen die ausführenden Firmen nicht einfach das, was sie auch umsetzen? Denn die wissen doch sehr genau, wie und ob es umsetzbar ist.
Aber in deinem Verantwortungs-Modell macht der Planer natürlich Sinn. Da muss es natürlich jemanden geben, der die ganzen Regularien und Berechnungen berücksichtigt. Das kann natürlich die ausführende Firma nicht machen. Das ist der Verantwortungsbereich des Planers.
Doro
Das ist ja auch die Frage der Expertise. Also wer kann was mit an den Tisch bringen? Und da sind wir wieder bei der Kommunikation. Man muss miteinander sprechen und man muss dieses unterschiedliche Wissen zusammenbringen, sodass alle abgeholt sind und wissen, was der Plan ist und warum wir das machen und wie wir es machen.
Was würdet ihr sagen, ist das Wichtigste im Projektmanagement bezogen auf menschliche Skills? Was muss man können, welche Führungserfahrungen muss man an den Tag legen?
Christian
Ja, Personen lesen ist glaube ich das Wichtigste. Zu erkennen, an welcher Stelle sich jemand mitgenommen fühlt, wo sich jemand abgehängt fühlt, wo werden Verantwortungsbereiche erkannt, wo sagt jemand, da ist er nicht für zuständig. Wie man mit jemandem kommunizieren kann, wie man jemanden auch kitzeln kann, sodass er vielleicht einen anderen Blickwinkel auf das Thema bekommt. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Punkte. Wenn man es mit so vielen Beteiligten zu tun hat, vom jungen Fachexperten bis zu erfahrenen Kollegen im Bundesamt, muss man mit jedem anders umgehen. Du kannst nicht alle über den gleichen Kamm scheren. Man muss erkennen, welches Werkzeug man an welcher Stelle verwendet. Wenn ich verschiedene Schrauben habe, brauche ich auch anderes Werkzeug dafür. Das ist bei Menschen das gleiche.
Doro
Coole Analogie! Und auch lustig, weil mir genau in dem Moment, wo du angefangen hast zu erklären, Christian, mein erster Impuls die Empathie gewesen wäre. Ich glaube, das trifft so ziemlich das, was du gerade gesagt hast. Also einfach dieses Verständnis, wie ich mit Menschen umgehe. Wie gehe ich mit der jeweiligen Situation und auch mit der jeweiligen Person um?
Christian
Wobei ich auch nicht immer Empathie als die Lösung für alles sehe. Mittlerweile! Ja, wir sind gute Kommunikatoren und wertschätzen uns alle, aber manchmal braucht es auch mal einen Rumms.
Ja. Aber mal als Gedankenexperiment: ist das nicht auch eine gute Eigenschaft, wenn in einem Projekt alle Projektbeteiligten professionelles Projektmanagement betreiben und man dann auf diskutabler Ebene Inhalte von Menschlichkeit trennen kann? Also wenn man hart diskutieren kann, es aber nicht persönlich nimmt.
Christian
Aber das zu trennen können meiner Meinung nach die wenigsten zu 100%, weil die Persönlichkeit bringt die Motivation mit. Für etwas brennen, für etwas kämpfen, für etwas motiviert sein, früh aufzustehen und Bock darauf zu haben. Das kann ich nur, wenn ich den Inhalt eben nicht vom Menschlichen trenne.
Sachliche Diskussionen müssen natürlich möglich sein. Also Argumente betrachten, nicht beleidigen, sich auf das Sachthema konzentrieren, das ist klar. Aber ich glaube, wenn ich bloß die Faktenlage habe, dann verliere ich vielleicht auch irgendwann die Lust.
Das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Wir sind ja auch Menschen, keine Maschinen. Es wird ja inhaltlich nicht falscher, wenn ein Stück weit Emotion in die Diskussion eingebracht wird. Harte und emotionale Diskussionen und persönliche Wertschätzung lassen sich meiner Meinung nach gut kombinieren, wenn man möchte und wirklich professionell diskutiert.
Christian
Ja, das ist klar, das setze ich ja voraus.
Aber ich weiß nicht genau, ob das beispielsweise bei zehn Leuten auch immer so ist. Ich glaube, dass zwischen den Zeilen auch viel auf persönlicher Ebene diskutiert wird, weil wir auch einfach Menschen sind und weil vielleicht nicht alle immer so ganz professionell sind. Dann ist vielleicht ein Projektbeteiligter beleidigt und die Diskussion kippt, weil er sagt: mit mir nicht!
Christian
Aber diese Reibung macht es doch gerade auch spannend. Reibung erzeugt doch Wärme. Wenn du quasi hart im Austausch bist, entsteht da eine neue Energie, als wenn alle so wahnsinnig professionell sind. Vielleicht habe ich in deiner Beschreibung auch ein falsches Bild im Kopf gehabt. Das wäre natürlich der Idealfall, wenn alle zu 100% professionell wären und dabei ein perfektes Ergebnis herauskäme. Aber durch die verschiedenen Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Religion und Erfahrung und was da nicht alles zustande kommt, da entsteht ja der größte Mehrwert. Da entstehen Innovationen, da entstehen Ideen, da entsteht Diversität im Tun. Das ist dann eine gute Lösung mit einem anderen Impuls dazu.
Eine sehr professionelle Einstellung, würde ich sagen.
Wir sind ja mit unserem Projekt in einem klassischen Projektmanagement Umfeld unterwegs, da ist ja nichts agil. Was im baulichen Umfeld auch keinen Sinn macht. Gibt es besonders wichtige Methoden aus dem Werkzeugkasten klassischer Projektmethoden, die für euch besonders wichtig sind?
Doro
Die Stakeholderanalyse hatten wir ja schon angesprochen. Ich würde sagen, der typische Terminplan und Projektablaufplan, das wären für mich die Grundlagen. Auch um das typische magische Dreieck kommen wir, glaube ich, nicht herum. Als klassisch agiles Tool, und ich bin kein Experte der Agilität, ist beispielsweise die Anwendung von Kanban zu benennen.
Jetzt sind wir zeitlich schon fast am Ende. Trotzdem habe ich hier noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde.
Führungskompetenz! Ihr seid ja zentralseitig unterwegs und dabei begleitet euch auch eine gewisse Führungskompetenz, die ihr abrufen müsst. Und dabei gibt es ja nicht nur die autoritäre Führungskompetenz, sondern beispielsweise auch die laterale Führungskompetenz usw. Wie wichtig ist Führungskompetenz für euch?
Doro
Ich würde sagen, eine wichtige Kompetenz in diesem Bereich ist die Vorbildfunktion. Das ist aus meiner Sicht eine typische Kompetenz für eine Führungskraft. Vorbild für das Team sein, auch das Tun in einem Projekt vorzuleben und sich dadurch Follower zu schaffen. Das macht wieder diese Menschlichkeit aus, warum ich in einem Projekt arbeiten will.
Und das wiederum gibt auch die Sicherheit und auch die Motivation, dass alle dem gleichen Ziel folgen.
Christian
Sagen wir mal Führung im Sinne von, es werden Entscheidungen getroffen. Ich glaube, es wäre noch wichtiger, dass wir vielleicht auch mal schneller zu einer Entscheidung kommen. Da haben wir jetzt schon ganz viel über Prozesse und über Beteiligte gesprochen. Das, was Doro sagt, kann ich absolut unterstützen. Einen Motivator darstellen, ein Leadership, der voran geht, der als Kapitän der Mannschaft gegenüber zuerst aufs Feld geht und da die Einsatztaktik mitbringt, um die Führungsfigur auf dem Spielfeld zu sein. Aber dann auch nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen nachvollziehbar machen für etwas, was passiert ist, um für alle Beteiligten den Hintergrund klar zu machen.
Das ist, glaube ich, in der Historie zu wenig passiert, zumindest in meiner Wahrnehmung. Da könnte man noch mehr auftreten im Sinne eines Spielkapitäns, wenn man in dieser Metapher nochmal bleibt. Und das würde ich schon als Führungskompetenz oder Führungsinstrument einordnen, also wo positioniert man sich? Sind wir quasi bloß leise im Hintergrund und versuchen Dinge von den etablierten Projektleiterinnen und Projektleitern fernzuhalten, von denen sie gar nichts wissen? Und genau das tun wir ja faktisch zu 90 Prozent in der Zentrale. Oder treten wir auf als Unterstützer, als Motivator, als derjenige, der aufs Spielfeld rennt und loslegt?
Ja, also sehr gut beschrieben, finde ich. Aber dann können wir an diesem Punkt ja nochmal genauer einsteigen. Also was macht ihr als Zentrale? Was ist eure Aufgabe?
Weil du ja auch vorher als fachtechnischer Projektleiter im Regionalbereich gearbeitet hast. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Also du kennst auch den Blick aus der Rolle des Projektleiters.
Christian
Also meine erste Wahrnehmung war, als ich in der Zentrale angefangen habe, dass wir einen großen Teil Berichtswesen machen. Dass wir quasi Informationen, die vorhanden sind, zusammenfassen und auf eine andere Ebene heben. Mit dem Versuch, dass dort ein Mehrwert passiert, der vielleicht zu einer Entscheidung, zu einer Nachvollziehbarkeit oder zu einer Priorisierung führt. Und in den meisten Fällen ist es genau das, was wir tun: dokumentieren, erfassen, zusammenfassen, strukturieren und es dort hintragen, wo zum Schluss Resultate erzielt werden. Das war so meine allererste Wahrnehmung in den ersten paar Wochen, seitdem ich in der Zentrale angefangen habe.
Was würde denn fehlen, wenn diese Informationen nicht da wären in der Zentrale?
Doro
Klar, Berichtswesen ist eine Sache, die wichtig ist. Wir haben viele Behörden und zentrale Stellen, die wir informieren müssen über Statis und die führen wir in der Zentrale zusammen und kommunizieren diese an die benötigten Stellen. Auch Zeitpläne oder Projektstände sind beispielsweise wichtige Informationen.
Auch ein wichtiges Thema ist die Wissenszusammenführung, was wir vorhin auch schon besprochen haben.
Der Wissensaustausch ist ein großer Bestandteil von dem, was wir tun. Es wäre noch mehr Aufwand aus meiner Sicht, wenn jeder sein eigenes Süppchen kochen würde. Dann müssen Probleme gelöst werden, die in anderen Region vielleicht schon gelöst worden sind. Oder die Zentrale hat noch eine Idee, wie man es anders machen könnte.
Aus meiner Sicht muss es jemanden geben, der den absoluten Überblick über das komplette Projekt hat. Wie ist der Stand? Was wird als nächstes geplant? Was ist passiert? Um beispielsweise bei Änderungen entsprechend reagieren und steuern zu können. Und das Projekt global voranzutreiben. Es muss jemanden geben, der das Projekt aus globaler Sicht im Blick hat. Und das ist meiner Meinung nach die Hauptaufgabe eines zentralen Gremiums. Bei oft geäußerter Kritik kann ich eure Position und das, was ihr tut, absolut nachvollziehen.
Christian
Zu meinem vorherigen ersten Impuls wollte ich gerne noch etwas ergänzen. Das war nicht so gemeint, dass wir bloß Zettel ausfüllen, nur damit wir die Kennzahlen aktualisiert haben. So wie es Doro schon gesagt hat, geht es genau um das Berichtswesen an die ganzen Gremien und auch um die Informationen, die von dort zurückkommen. Informationen wie projektspezifische Entscheidungen, technische Informationen, Vorgaben, Herausforderungen, um diese zu steuern und zusammenzuhalten.
Das sind wichtige Themen. Du arbeitest manchmal auf etwas hin, wo du denkst, das brauchst du vielleicht in einem halben Jahr irgendwann mal für eine strategische Anfrage oder für eine strategische Entscheidung. Dafür muss ich aber jetzt schonmal die Voraussetzung schaffen, dass ich dann die Informationen habe, die ich dann brauche. Das alles zusammenzufassen, das ist total wichtig. Und das sieht man aber quasi auf der Werkbank nicht. Aber in der Zentrale ist das super relevant.
Eine letzte Frage noch. Wie händelt ihr den Umgang mit externen Mitarbeitern im Vergleich zu internen Mitarbeitern? Das ist in Projekten in größeren Unternehmen ja gängige Praxis, dass externe Mitarbeiter reingeholt werden. Externe Mitarbeiter spielen einfach eine große Rolle und bringen ggf. neuen Input in das Projekt.
Aber sie spielen natürlich eine andere Rolle, weil sie in unserem Fall beispielsweise nicht das fundierte Bahnwissen mitbringen. Inwieweit ist das positiv oder negativ für das Projekt?
Christian
Also ich finde das super, dass frischer Wind und neue Luft reinkommt. Es ist natürlich ein großer Geldfaktor. Ich habe gerade erst wieder an der Bahnblogstelle gelesen, wie viel IT-Beratungsgeld die Bahn letztes Jahr ausgegeben hat. Irre, wenn du die Gesamtsumme dann liest. Aber trotzdem ist es für so ein Programm, für so ein Projekt aus meiner Sicht total wichtig, dass man nicht bloß wie der Sachse sagt, in der eigenen Wurstsuppe schwimmt, sondern dass man über den eigenen Tellerrand hinaus schaut. Und das kann man nicht, wenn man in den Regelabläufen der Bahn einfach bleibt. Das ist wahrscheinlich in anderen Projekten genauso, dass jemand mit einem anderen Fokus, mit einer anderen Idee dort reinkommt. Also ich finde, dass das ein Bestandteil ist, der wichtig ist.
Doro
Also, da bin ich voll bei dir, Christian, das würde ich auch nicht anders behaupten. Ich glaube und hoffe auch, dass es uns gelingt. Also mir fällt es an der einen oder anderen Stelle auch nicht auf, wer extern ist oder nicht, weil für mich sind alle gleichwertige Projektbeteiligte und genauso engagiert und haben das gleiche Ziel vor Augen wie jeder andere auch. Rein inhaltlich sollte man das nicht voneinander trennen. Für uns als Programm, also zentralseitig betrachtet, ist es absolut wertvoll und wichtig, dass es die Kollegen gibt und dass wir die Möglichkeit haben, auf zusätzliche Unterstützung, zusätzliches Wissen, Kompetenzen und Expertisen in vielen Fällen zugreifen zu können.
Der Vorteil von externen Mitarbeitern ist natürlich, dass sie nicht in dem All-Day-Business Sumpf drin stecken, sondern dass sie out of the box denken und mit ihren Expertisen neue Impulse setzen können. Neue Projektmanagement Skills einbringen, Prozesse hinterfragen und das Projekt mit ihrer Sicht von außen vorantreiben. Auf der anderen Seite kosten externe Mitarbeiter sehr viel Geld. Die Bahn investiert natürlich Geld in die Mitarbeiter, die sich unternehmensspezifisches Wissen aufbauen. Und diese investierte Expertise ist am Ende weg.
Gut, vielen Dank für das Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da waren viele wertvolle Informationen dabei und wir haben zwischendurch auch ein bisschen diskutieren können.
Christian
Gleichfalls.
Doro
Danke dir.
Metadaten
Durchführung Interview: 08.11.2024 (remote)
Interviewsprache: deutsch
Interviewer: Stephan Bellmann
Interviewpartner: Dorothee Glöckner & Christian Jahr
Autorisierung Christian Jahr: 15.04.2025
Autorisierung Dorothee Glöckner: 16.04.2025




Kommentare