Produktionsingenieur bei ABB
- Stephan Bellmann
- 4. Aug. 2025
- 9 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 19. Nov. 2025
Zwischen Smart Factory und Realität: Marco Sturm über den sinnvollen Einsatz von Digitalisierung und Automatisierung in der Produktion.
Über Marco Sturm
Marco ist seit fast elf Jahren bei ABB tätig. Nach einem dualen Studium im Wirtschaftsingenieurwesen an der DHBW Mannheim (2014–2017) war er zunächst als Engineering Student an den Standorten Lüdenscheid und Heidelberg eingesetzt. Seit Oktober 2017 arbeitet er fest als Production Development Specialist am Standort Heidelberg, wo er die Entwicklung und Optimierung von Produktionsprozessen mit verantwortet.

Zusammenfassung des Interviews
Marco hat ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt auf Produktion und Logistik absolviert. Ursprünglich interessierte er sich für das Controlling, entschied sich dann aber bewusst für das Wirtschaftsingenieurwesen, um sich sowohl betriebswirtschaftliche als auch technische Karrierewege offen zu halten. Diese Entscheidung erwies sich als richtig, denn im Laufe des Studiums entwickelte er eine große Begeisterung für technische Themen. Auch wenn er heute rückblickend ein noch technischer ausgerichtetes Studium wie Mechatronik in Erwägung ziehen würde, schätzt er den betriebswirtschaftlichen Anteil sehr, da er ihm hilft, Themen ganzheitlich zu betrachten.
Nach seinem Studium blieb Marco seinem Praxisunternehmen treu: Er ist seit mittlerweile zehn Jahren bei ABB tätig – inklusive der drei Jahre während seines dualen Studiums. Heute arbeitet er dort als Production Development Specialist, also als Produktionsingenieur, und betreut eine vollautomatische Produktionslinie. Zu seinen Aufgaben gehört die gesamtheitliche Begleitung der Produktionstechnologie über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Dazu zählen unter anderem die fertigungsgerechte Produktgestaltung, die Planung und Beschaffung von Produktionsanlagen, die Inbetriebnahme und Prozessoptimierung sowie das Ersatzteilmanagement. Besonders wichtig sind in seinem Bereich Methoden wie Kaizen, KVP und Lean Management.
Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Automatisierung und Integration neuer Technologien. Ein Beispiel dafür ist ein internes Projekt bei ABB in Heidelberg, bei dem gemeinsam mit der Robotiksparte eine automatisierte Zuführung filigraner Teile entwickelt wurde. Durch den Einsatz von Kameratechnik und intelligenter Bildverarbeitung können selbst empfindliche Komponenten wie Spezialfedern präzise erkannt und verarbeitet werden. Solche Innovationen haben die Effizienz und Qualität in der Produktion erheblich gesteigert.
ABB in Heidelberg ist in den letzten Jahrzehnten stark automatisiert worden – ohne dabei bestehende Arbeitsplätze durch den Technologiewandel zu verlieren. Veränderungen wurden vor allem durch natürliche Fluktuation umgesetzt. Trotzdem ist Marco bewusst, dass Veränderungsprozesse sensibel gestaltet werden müssen, da sie auch Widerstände hervorrufen können. Entscheidend ist daher die frühzeitige Einbindung aller Beteiligten.
Ein zentrales Thema in Marcos Arbeitsumfeld ist Industrie 4.0. Dabei geht es um die Vernetzung von Steuerungstechnik, ERP- und MES-Systemen, Robotik, Kamerasystemen sowie fahrerlosen Transportsystemen. Die Produktionsanlagen generieren heute riesige Datenmengen, deren Auswertung enorme Potenziale für Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit und Prozessoptimierung bietet. Marco betont jedoch, dass Digitalisierung nicht per se zu besseren Prozessen führt – sie muss sinnvoll geplant und in die Unternehmensstrategie eingebettet werden. Der bloße Einsatz neuer Technologien bringt keinen Mehrwert, wenn sie nicht konkret zur Wertschöpfung beitragen.
Insgesamt sieht Marco Industrie 4.0 als eine große Chance, die jedoch differenziert betrachtet werden muss. Die technologische Entwicklung sei essenziell für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, dürfe aber nicht unkritisch übernommen werden. Der Schlüssel liegt für ihn darin, neue Technologien mit strategischem Weitblick und einem offenen, reflektierten Mindset zu nutzen.
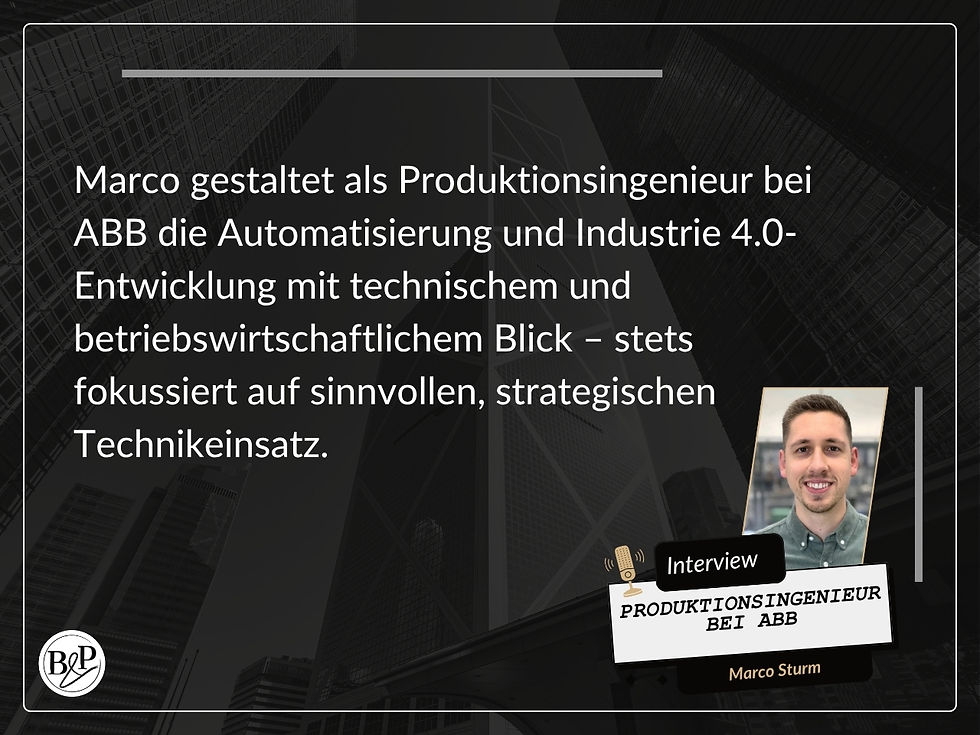
Kernaussagen
Ausbildung und beruflicher Werdegang
Marco hat ein duales Studium im Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Produktion und Logistik absolviert. Ursprünglich interessierte er sich für Controlling, entdeckte jedoch während des Studiums seine Leidenschaft für Technik. Rückblickend hätte er sich eventuell ein technischer orientiertes Studium wie Mechatronik vorstellen können, ist aber mit seiner Entscheidung sehr zufrieden.
Technologische Innovationen
Ein Schwerpunkt liegt auf Automatisierung und Digitalisierung. Marco nennt ein Projekt zur automatisierten Zuführung von filigranen Bauteilen mithilfe von Vibrationsplatten, Kameratechnik und Robotik als Beispiel für erfolgreiche interne Innovation. Dadurch konnten Taktzeiten verbessert und sensible Prozesse automatisiert werden.
Veränderungen durch Automatisierung
ABB in Heidelberg hat die Produktion stark automatisiert. Dabei gingen keine Arbeitsplätze verloren – Veränderungen wurden durch natürliche Fluktuation kompensiert. Widerstände gegenüber neuen Technologien bestehen vereinzelt, weshalb frühzeitige Einbindung und Kommunikation besonders wichtig sind.
Industrie 4.0 und Digitalisierung
Industrie 4.0 spielt in Marcos Arbeitsalltag eine zentrale Rolle – etwa durch die Integration von MES, ERP, SCADA, Robotik und Kameratechnik. Die Anlagen generieren große Datenmengen, deren sinnvoller Einsatz entscheidend ist. Digitalisierung muss ganzheitlich gedacht und kritisch hinterfragt werden. Neue Technologien sollten nicht blind eingeführt, sondern strategisch geprüft werden.
Interview
Marco, du hast ein duales Studium absolviert. Was genau hast du studiert?
Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Produktion und Logistik studiert.
Also ein guter Mix aus Betriebswirtschaft und Technik?
Genau. Durch den gewählten Fokus ging es verstärkt in Richtung technischer Prozesse, was mir sehr entgegenkam. Ursprünglich wollte ich eigentlich ins Controlling, weil ich ein Faible für Zahlen habe. Dann habe ich mich aber für Wirtschaftsingenieurwesen entschieden, da ich mir damit auch die technischen Türen offenhalten konnte – und das war rückblickend genau richtig. Die Technik hat mich voll gepackt, und ich bin heute froh, nicht "nur" BWL gemacht zu haben. Die betriebswirtschaftlichen Inhalte sind natürlich wichtig, um das große Ganze zu verstehen – also, wie Entscheidungen im Unternehmen zustande kommen. Aber meine Leidenschaft liegt definitiv auf der technischen Seite.
Wenn du heute nochmal vor der Entscheidung stehen würdest – würdest du wieder Wirtschaftsingenieurwesen studieren oder eher ein klassisches Ingenieurstudium?
Gute Frage. Es ist schwer, das eindeutig zu beantworten. Ich profitiere bis heute vom BWL-Wissen, weil ich dadurch manche Themen aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Aber rückblickend würde ich vielleicht doch ein noch technischer ausgerichtetes Studium wählen – zum Beispiel Mechatronik – um noch tiefer in die Technik einzutauchen. Andererseits: Wenn ich dann rein technisch studiert hätte, würde ich möglicherweise heute sagen, ich hätte lieber Wirtschaftsingenieurwesen gemacht. Es ist eben beides wertvoll. Und insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner Wahl, weil ich heute genau das mache, was mir Spaß macht.
Man entwickelt sich ja auch mit den Jahren weiter. Vor zehn Jahren hat man eine andere Erfahrung und andere Interessen als heute. Deshalb ist es normal, dass man mit dem heutigen Wissen vielleicht einen anderen Weg gewählt hätte. Aber mit deinem damaligen Wissen war Wirtschaftsingenieurwesen absolut sinnvoll – und hat dich ja auch dahin gebracht, wo du heute stehst.
Das stimmt. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es besser gewesen wäre, vorher eine technische Ausbildung zu machen. Gerade in der Produktion ist ein solides technisches Grundverständnis extrem wertvoll. Heute, nach fast zehn Jahren Berufserfahrung, habe ich mir vieles angeeignet. Eine technische Ausbildung hätte mir da sicher ein gutes Fundament gegeben.
Das kenne ich aus meinem eigenen Studium. Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Einige Kommilitonen hatten vorher eine Ausbildung als Fluggerätmechaniker gemacht. Die wussten genau, wie ein Triebwerk aussieht, wie man daran schraubt – die hatten einfach ein Gefühl für Technik. Für mich war vieles erst einmal nur Theorie. Ich musste mir vieles anhand von Bildern oder Erklärungen herleiten. Diejenigen mit Ausbildung hatten da einfach einen großen Vorsprung im technischen Verständnis.
Das merke ich jetzt auch, während meines aktuellen Masterstudiums Industrial Engineering and Management. Hätte ich den Master direkt im Anschluss an den Bachelor gemacht, hätte ich wahrscheinlich viele Dinge einfach hinnehmen müssen – ohne sie ausreichend hinterfragen zu können. Durch meine Praxiserfahrung kann ich jetzt das Wissen ganz anders einordnen und kritisch reflektieren. Natürlich war es schwer, nach sieben Jahren wieder in den Lernrhythmus reinzukommen. Aber der Mehrwert ist heute viel größer, weil ich die Theorie mit der Praxis verknüpfen kann.
Absolut.
Kommen wir mal zu deiner aktuellen Tätigkeit: Du arbeitest bei ABB – und das nicht erst seit Kurzem. Wie lange bist du schon dabei?
Ich habe dieses Jahr mein zehnjähriges Jubiläum gefeiert – inklusive der drei Jahre im dualen Studium. Das heißt, sieben Jahre bin ich nun als fertig ausgebildeter Ingenieur im Unternehmen.
Das spricht ja für ABB als Arbeitgeber. Wie gefällt es dir dort?
Sehr gut. Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl.
ABB ist ein großes Unternehmen. Was ist das Kerngeschäft?
Kurz gesagt: Alles rund um Elektrifizierung und Automatisierung. Das reicht unter anderem von der Steckdosen, Sicherungsschaltern und KNX-Systemen, über Mittelspannungsschaltanlagen bis hin zu Robotik, SPSen, Mess- und Analysetechnik, Frequenzumrichtern und Motoren. Das Portfolio ist sehr breit, ergänzt sich aber intern hervorragend.
Man sieht den ABB-Schriftzug ja öfter – zum Beispiel auf Sicherungskästen oder FI-Schaltern.
Genau – da begegnet man ABB wahrscheinlich am ehesten. Ich möchte auch behaupten, dass du täglich mehrfach an Produkten von ABB vorbeiläufst, ohne sie wahrzunehmen, die im Hintergrund wirken und deinen Alltag sicherer und einfacher machen.
Was genau ist denn deine Rolle bei ABB?
Ich bin als Production Development Specialist tätig – auch Produktionsingenieur genannt. Ich begleite die gesamte Produktionstechnologie über den Produktlebenszyklus hinweg. Das beginnt bei der Geräteentwicklung: Wie kann man ein Produkt fertigungsgerecht gestalten? Wie soll produziert werden – manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch? An welchem Standort? Dann kümmere ich mich um die Beschaffung der Produktionsanlagen, um deren technische Auslegung, begleite den Serienanlauf, optimiere laufende Prozesse und übernehme auch das Ersatzteilmanagement, damit unsere Anlagen langfristig zuverlässig funktionieren.
Also sind Themen wie Kaizen, KVP oder Lean bei dir auch auf der Agenda?
Definitiv. Diese Methoden sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit – sowohl für mich als auch für mein gesamtes Team.
Gibt es bei euch im Zuge des technologischen Fortschritts konkrete Innovationen in der Produktion?
Ja, auf jeden Fall. Ein Beispiel ist die Kameratechnik. Da tut sich viel – sowohl durch den technischen Fortschritt an sich als auch durch den zunehmenden Einsatz von KI. Besonders spannend ist es, wenn wir Prozesse automatisieren, die früher ausschließlich manuell möglich waren. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Zum Beispiel im Bereich der Zuführtechnik. Früher war es extrem schwierig, sehr leichte oder filigrane Teile wie Kunststoffteile oder Federn automatisiert zuzuführen. Wir haben gemeinsam mit unseren Kollegen und Kolleginnen von ABB-Robotik eine Lösung entwickelt, bei der die Teile über eine Vibrationsplatte vereinzelt werden. Eine Kamera erkennt mithilfe von Gegenlicht die genaue Lage und Orientierung der Teile. Die Bildverarbeitung analysiert, welche Teile abgreifbar sind, und übermittelt dem Roboter die Koordinaten. So können wir bis zu 23 Takte pro Minute realisieren – sogar bei so sensiblen Teilen wie Spezialfedern, die sich leicht ineinander verhaken. Die Kamera erkennt "Klumpen" und sortiert sie aus, damit Platz für neue Federn geschaffen wird. Das war ein spannendes Projekt, das wir intern bei ABB gemeinsam realisiert haben – und es hat viele neue Möglichkeiten für andere Anwendungen eröffnet.
Ihr konntet durch Automatisierung deutlich effizienter werden. Wie habt ihr die Produktionsprozesse vorher umgesetzt?
Früher wurde vieles manuell oder halbautomatisch umgesetzt. Die Automatisierung hat natürlich enorme Vorteile gebracht – vor allem Effizienzgewinne und Qualitätssteigerungen.
Wie viele Produktionslinien betreust du aktuell?
Ich betreue eine vollautomatische Produktionslinie, wobei wir sechs in unserer Halle im Einsatz haben.
Und diese Linien werden kontinuierlich weiterentwickelt. Wie reagieren die Mitarbeitenden auf diese Veränderungen? Gibt es da Widerstände?
Das ist sehr unterschiedlich. In unserem Werk in Heidelberg beispielsweise ist die Produktion inzwischen bis auf wenige Ausnahmen vollständig automatisiert. Das ist eine unserer Kernkompetenzen. Wenn man sich allerdings Fotos von vor zwanzig, dreißig Jahren anschaut oder mit langjährigen Kollegen und Kolleginnen spricht, erkennt man schnell, dass damals noch vieles manuell und halbautomatisiert gemacht wurde. Interessant ist: Durch die Automatisierung sind im Wesendlichen keine bestehenden Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Veränderungen wurden meist durch natürliche Fluktuation, etwa durch Renteneintritte, abgefangen.
Auch heutzutage sind Veränderungen sehr präsent, vorwiegend durch komplexere Maschinen und die voranschreitende Digitalisierung. Wir versuchen alle frühzeitig zu involvieren und die Notwendigkeit sowie die Konsequenzen der angestrebten Veränderung aufzuzeigen. Natürlich reagiert jeder und jede unterschiedlich darauf, insbesondere wenn es die eigene Arbeitsweiße betrifft, die teilweise über mehrere Jahrzehnte Bestand hatte. Widerstände können dabei ebenso entstehen. Deshalb ist es so entscheidend alle in den Veränderungsprozess frühzeitig einzubinden und alle Meinungen und Reaktionen ernst zu nehmen.
Welche Rolle spielt Industrie 4.0 konkret in deinem Produktionsumfeld?
Eine große. Insgesamt verschmelzen heute Steuerungstechnik (PLC, SCADA), ERP-Systeme und MES-Lösungen zu einer durchgängigen digitalen Infrastruktur. Fahrerlose Transportsysteme (AGVs) navigieren autonom durch unsere Hallen, erkennen ihre Position per Kamera und wissen wohin sie müssen. Kameratechnik ersetzt heute teilweise klassische Sensorik – und erkennt gleichzeitig deutlich mehr. Auch Robotik spielt eine wichtige Rolle.
Unsere Anlagen erzeugen mittlerweile sehr viele Daten. Die zentrale Frage ist: Was mache ich mit diesen Daten? Wir können heute genau nachvollziehen, wann ein Gerät produziert wurde, von wem, mit welchen Qualitätswerten, mit welchen Materialchargen – wir haben die komplette Historie. Diese Daten helfen, Trends zu erkennen, Probleme frühzeitig zu identifizieren und Rückkopplungen im Prozess zu ermöglichen. Das alles ist Teil von Industrie 4.0. Entscheidend ist, dass die Digitalisierung ganzheitlich gedacht wird – also auch in Planungs- und Administrationsprozesse hinein.
Wenn wir den Blick über ABB hinaus auf die deutsche Industrie richten: Ist Industrie 4.0 wirklich so wichtig wie medial dargestellt – oder wird das Thema überschätzt?
Das Thema hat viele Facetten und Industrie 4.0 bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Es entstehen stetig neue Möglichkeiten, welche gezielt auf den konkreten Anwendungsfall hin hinterfragt und realisiert werden müssen. Denn nur weil ich einen Prozess digitalisiere, muss es nicht bedeuten, dass dieser dadurch auch besser und schlanker wird. Beispielsweise bedeuten mehr Daten nicht unmittelbar mehr Mehrwert. Ich muss mit den Daten arbeiten können, um daraus einen Mehrwert zu generieren. Ich denke, Industrie 4.0 ist wichtig, wegweisen und bringt viele mehrwertstiftende Enabler mit sich. Der Nutzen ist stark branchen- und unternehmensabhängig. Vielleicht werden teilweise aber die damit verbundenen Herausforderungen unterschätzt. Entscheidend ist, dass man sich mit den konkreten Möglichkeiten auseinandersetzt. Wer die Entwicklungen ignoriert, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren.
Das sehe ich sehr ähnlich. Begriffe wie Agilität oder KI klingen oft wie Buzzwords, sind aber – richtig umgesetzt – essenziell. Wer heute nicht beginnt, seine Prozesse zu flexibilisieren, könnte in Zukunft von der VUCA-Welt überrollt werden.
Ganz genau. Man muss sich generell kritisch mit neuen Technologien auseinandersetzen: Passen sie zum eigenen Produkt? Zur Produktion? Zur Unternehmenskultur? Zur Strategie? Gleichzeitig müssen teilweise auch Risiken eingegangen werden, um die Potenziale dieser neuen Technologien entdecken zu können. Wir prüfen beispielweise bei neuen Produktionsanlagen immer, ob neue Technologien sinnvolle Ergänzungen darstellen – nicht nur, weil sie neu sind und einen unmittelbaren Mehrwert bieten, sondern weil sie potenziell neue Chancen für die Zukunft eröffnen. Manchmal merkt man erst im Nachhinein, welche weiteren Automatisierungsmöglichkeiten sich daraus ergeben.
Vielen Dank für das interessante Gespräch, Marco!
Danke dir – gerne wieder.
Metadaten
Durchführung Interview: 05.02.2025 (remote)
Autorisierung: 26.08.2025
Interviewsprache: deutsch
Interviewer: Stephan Bellmann
Interviewpartner: Marco Sturm




Kommentare