Was kann bei einer Business Case Analyse schiefgehen?
- Stephan Bellmann
- 20. Okt. 2025
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 10. Dez. 2025
Typische Fehler und Fallstricke bei der Business Case Analyse im Projektmanagement – wie sorgfältige Planung, realistische Annahmen und regelmäßige Validierung den Projekterfolg sichern.
Eine Business Case Analyse dient dazu, den wirtschaftlichen Nutzen, die Machbarkeit und die Risiken eines Projekts zu bewerten. Sie ist Grundlage für Projektentscheidungen und sollte daher sorgfältig, realistisch und nachvollziehbar erstellt werden. Darüber hinaus dient sie nicht nur als Entscheidungshilfe für den Projektstart, sondern auch dazu, das Risiko des Scheiterns zu minimieren. Zwar können vor Beginn eines Projekts nicht alle Eventualitäten vorhergesehen werden, jedoch hilft die Analyse dabei, ein gutes Verständnis für relevante Einflussfaktoren zu entwickeln, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit besser einschätzen zu können. Die Business Case Analyse ist somit keine Garantie für den Projekterfolg, sondern eine möglichst genaue Orientierung hinsichtlich des erwarteten Nutzens und der Erfolgswahrscheinlichkeit. Dennoch können in der Praxis verschiedene Fehler auftreten, die zu falschen Entscheidungen oder Problemen im Projektverlauf führen.
1. Unvollständige oder fehlerhafte Datengrundlage
Eine sorgfältige und vollständige Datenerhebung ist essenziell für die Qualität eines Business Cases. Eine häufige Ursache für fehlerhafte Analysen ist eine unvollständige oder unzuverlässige Datengrundlage. Wenn Kosten, Nutzen oder Risiken nur teilweise oder gar nicht erfasst werden, entsteht ein verzerrtes Bild. Auch der Einsatz veralteter oder ungesicherter Zahlen ohne Quellen führt zu Fehleinschätzungen. Zudem werden oft externe Faktoren oder Abhängigkeiten zu anderen Projekten oder Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt, was die Aussagekraft der Analyse stark einschränkt.
2. Unrealistische Annahmen
Ein weiterer Fehler entsteht durch unrealistische Annahmen. Überoptimistische Zeit- und Kostenpläne führen zu Enttäuschungen im Projektverlauf, während ein unterschätzter Ressourcenbedarf schnell zu Engpässen und Verzögerungen führt. Fehlende Szenario-Analysen, wie Best Case oder Worst Case, verhindern zudem eine realistische Einschätzung von Risiken und Chancen.
3. Falsche Prioritäten oder einseitige Betrachtung
Oft liegt der Fokus der Analyse ausschließlich auf finanziellen Aspekten, während qualitative Faktoren wie Image, Kundenzufriedenheit oder strategische Unternehmensziele vernachlässigt werden. Eine einseitige Betrachtung kann dazu führen, dass das Projekt trotz positiver wirtschaftlicher Kennzahlen nicht den gewünschten strategischen Mehrwert liefert.

4. Fehlende Einbindung relevanter Stakeholder
Wenn Fachbereiche oder Experten nicht in die Analyse einbezogen werden, bleiben Risiken, Anforderungen und kritische Informationen oft unberücksichtigt. Dies kann nicht nur zu Fehlentscheidungen führen, sondern auch die Akzeptanz der Analyseergebnisse innerhalb des Unternehmens verringern.
5. Mangelnde Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Business Cases, die eine unklare Struktur aufweisen oder auf Annahmen basieren, die nicht begründet werden, erschweren die Nachvollziehbarkeit. Begründete Entscheidungsgrundlagen sollten daher transparent einsehbar sein, um Vertrauen zu schaffen und Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Ohne eine sorgfältige Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen können Ergebnisse leicht hinterfragt werden, was die Entscheidungsfindung verzögert oder kompromittiert.
6. Überdimensionierung der Analyse
Manchmal wird der Business Case zu umfangreich und bürokratisch erstellt. Eine Analyse ist insbesondere dann überdimensioniert, wenn der Aufwand an Zeit und Ressourcen in keinem Verhältnis zum Projektumfang oder zur Entscheidung steht. Wird zu viel Detailtiefe erzeugt, ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn, verzögert dies den Projektstart und erschwert den Fokus auf die wesentlichen Aspekte. Ein typisches Beispiel ist ein kleines IT-Tool mit geringem Budget, für das aufwendige Marktanalysen, komplexe Szenario-Berechnungen und mehrere Abstimmungsschleifen erstellt werden, obwohl eine schlanke Nutzen-Kosten-Abwägung völlig ausgereicht hätte. In solchen Fällen wird die Analyse zum Selbstzweck und verliert ihren praktischen Nutzen.
7. Unterdimensionierung oder fehlende Inhalte
Umgekehrt kann eine unterdimensionierte Analyse ebenfalls problematisch sein. Besonders in großen und komplexen Projekten ist eine sorgfältige Analyse entscheidend, um Risiken, Abhängigkeiten und langfristige Auswirkungen zu verstehen. Wenn wichtige Kostenpositionen oder Risiken nicht erfasst werden, Alternativen unberücksichtigt bleiben oder der Nutzen nicht ausreichend bewertet wird, entsteht ein unvollständiges Bild. Ein typisches Beispiel ist ein umfangreiches Infrastrukturprojekt, das ohne gründliche Risiko- und Kostenanalyse gestartet wird und später massive Budgetüberschreitungen und Verzögerungen verursacht. Entscheidungen basieren in diesem Fall auf unzureichenden Informationen.
8. Keine regelmäßige Aktualisierung (Validierung im Projektverlauf)
Ein Business Case ist nur dann aussagekräftig, wenn er während der Projektdurchführung regelmäßig überprüft und aktualisiert wird. Solche Aktualisierungen sollten mindestens nach dem Erreichen einer Projektphase oder bei wichtigen Meilensteinen erfolgen, um Veränderungen im Projekt oder Umfeld rechtzeitig zu berücksichtigen. Dabei werden Einflussparameter, die für die Bewertung entscheidend sind, aus der Risikoanalyse und dem Changemanagement abgeleitet. Wird die Analyse nur zu Beginn erstellt und später ignoriert, können Entwicklungen wie Marktbedingungen oder gesetzliche Vorgaben unbemerkt bleiben. Entscheidungen basieren dann möglicherweise auf veralteten Annahmen.
9. Politische oder persönliche Einflussnahme
Ein weiterer Risikofaktor ist die politische oder persönliche Einflussnahme. Ergebnisse können bewusst „geschönt“ werden, um ein Projekt durchzusetzen, wodurch die Objektivität verloren geht. Dies kann zu falschen Priorisierungen und Entscheidungen führen, die dem Unternehmen langfristig schaden.
10. Fehlende Verknüpfung mit der Projektsteuerung
Schließlich ist es entscheidend, dass der Business Case mit der Projektsteuerung verknüpft wird. Wenn er nicht als Referenz für Erfolgsmessung genutzt wird oder keine Verbindung zu KPIs, Budget und Risiko-Management besteht, verliert er seinen praktischen Nutzen. Ohne diese Integration werden Potenziale zur Steuerung und Kontrolle des Projekts ungenutzt.
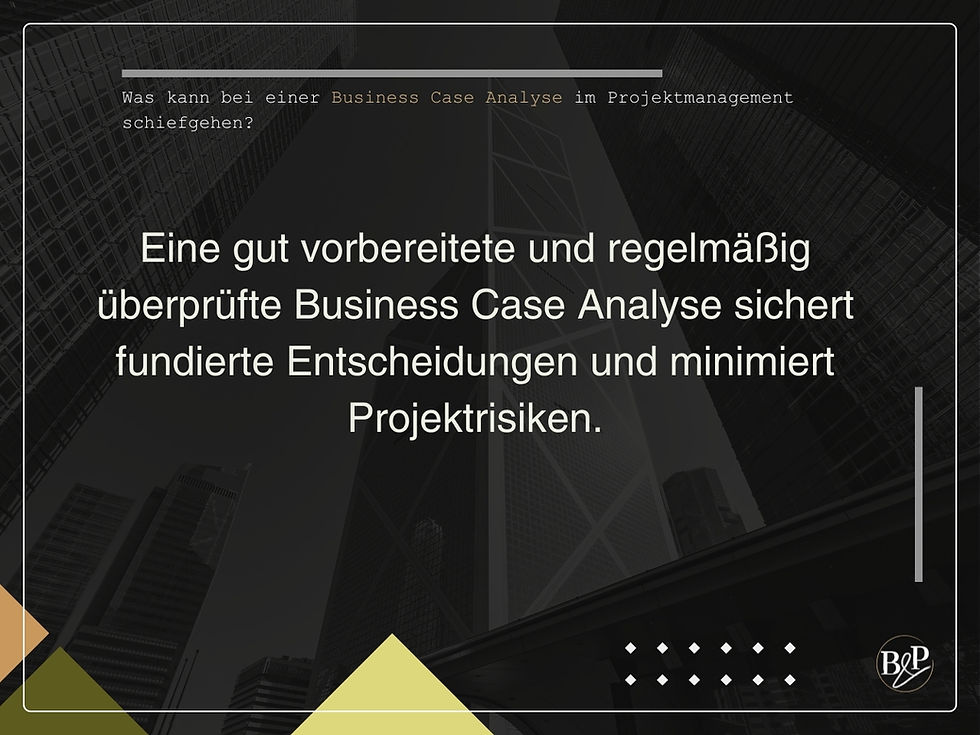
Fazit:
Eine Business Case Analyse kann nur dann als solide Entscheidungsgrundlage dienen, wenn sie vollständig, realistisch, transparent und regelmäßig überprüft wird. Sowohl Über- als auch Unterdimensionierung sowie fehlende Validierung im Projektverlauf können zu Fehlentscheidungen führen und den Projekterfolg gefährden. Daher ist es wichtig, die Analyse strukturiert zu erstellen, relevante Stakeholder einzubinden und sie als „lebendes Dokument“ im Projektmanagement zu nutzen.




Kommentare